Wiener Staatsoper: "Lucia di Lammermoor" mit Anna Netrebko
Der etwas andere Wahnsinn der Anna N.
Boleslaw Barlogs "Lucia di Lammermoor" hat in dreißig Jahren Hausgeschichte am Ring viele Höhen und Tiefen erlebt, große und kleine Änderungen gab es, aber ein Fixstern blieb: Die slowakische Nachtigall Edita Gruberová ist seit der Premiere 1978 untrennbar mit der Inszenierung verbunden.
Just die Eroberung dieses Heiligtums hat sich eine der berühmtesten Jungmütter der Opernwelt für ihr Bühnencomeback gewählt: Big Anna is back! Nach keinem vollen Jahr Babypause zog es Anna Netrebko, Wahlwienerin aus Leidenschaft, zurück ins heimische Scheinwerferlicht – unterstützt vom typischen Tross aus Plattenindustriellen, Kunstconnaisseuren und Luxusgroupies.
Nach dem New Yorker Fehlstart kündigte Staatsoperndirektor Holender vorsichtshalber die etwas andere Lucia an. Wer braucht schon ein hohes Es in der Wahnsinnsarie? Auch für Urheber Donizetti war es nicht vonnöten. Tatsächlich sollte es ein Erlebnis der eigenen Art werden: Netrebkos lyrisch-dramatischer Zugang kannte keine koloraturtechnischen Spitzen, dafür konnte sie mit ihrem zerbrechlichen Schauspiel punkten. Genauso mit ihrer zarten, dennoch das gesamte Haus durchdringenden Mittellage und den ausdrucksvollen Parlandi. Ihre Lucia war von Anfang an ein gebranntes Kind, das dem Untergang entgegenblickte.
Bei den männlichen Debütanten gab es wenige Lichtblicke: George Peteans solide Auftritte als böser Bruder Enrico gehörten dazu. Edgardos (Giuseppe Filianoti) gezwungene Höhen traten spätestens in seiner Abschiedsszene "Fra poco a me ricovero" ungeschminkt ans Tageslicht, Marian Talaba gab einen bescheidenen Widersacher Arturo.
Ein Duett und die Glasharmonika
Nicht genug der Änderungen fand im zweiten Akt das gestrichene Duett Lucias mit ihrem Erzieher Raimondo (überzeugend: Stefan Kocán) auf die Bühne – ein musikhistorisches Kleinod, wenn auch dramatisch entbehrlich. Weniger klein fiel der eigentlich sensationelle Gastauftritt aus: Lucias Wahnsinnsszene wurde diesmal nicht von der Flöte, sondern, wie vom Komponisten ursprünglich intendiert, von der Glasharmonika perfektioniert. Alexander Marguerre vollbrachte unheimliche Klänge, die einen schlicht erschaudern ließen.
Ähnliches galt für die zahlreich misslungenen Choreinsätze. Wobei Debütant Marco Armiliato am Pult zumindest das Staatsopernorchester denkbar gut unter Kontrolle hatte. Im gewissenhaft einstudierten Sextett "Chi mi frena" wurde deutlich: Alles in allem wird sich dieses Team bestimmt noch einspielen.
A favorite bass performance from Carmen Paddock
vor 5 Stunden
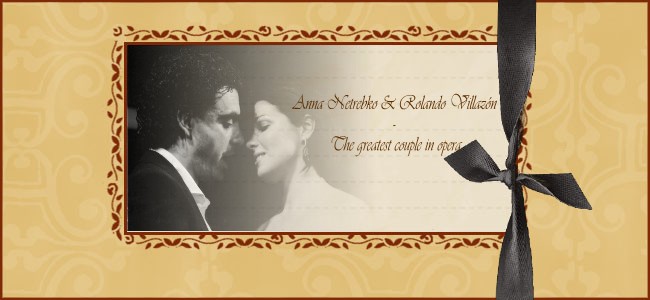


.jpg)



.jpg)

.jpg)


.jpg)


.png)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)


.jpg)
.jpg)





.jpg)
.jpg)


.bmp)


.jpg)

.jpg)




+2.jpg)
.jpg)






















Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen