Metallene Strahlkraft und sanfte Intimität
Anna Netrebko begeistert in "Lucia di Lammermoor"
Wien - Das Zeitalter des Barock ist in Wien offenbar noch lange nicht zu Ende. In keiner anderen Stadt der Welt werden die Details aus dem Alltag einer Sängerin, vor allem wenn diese Anna Netrebko heißt, mit solch sabberndem Enthusiasmus protokolliert wie in Wien. Weil diese Protokolle ja wohl auch nur in Wien auf dieses geradezu fiebernde Interesse der Öffentlichkeit stoßen:
Lappalien wie zum Beispiel, in welchem Lokal und mit welchen Speisen sie ihren Appetit zu stillen geruht, werden ebenso andächtig zur Kenntnis genommen, wie die Nachricht der Staatsoperndirektion, dass die Netrebko tatsächlich anwesend ist und mit den Proben für Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor begonnen hat, allgemein ein erleichtertes Seufzen ausgelöst hat.
Betörende Bravour
Nun hat dieser Popstar der Opernszene aber nicht nur geprobt, sondern sie hat am Samstag die Lucia auch tatsächlich gesungen. Im Rausch der Begeisterung für die Bravour, die sie dabei bewiesen hat, könnte so mancher versucht sein zu sagen, sie hat die Lucia nicht nur gesungen, - sie ist sie gewesen. Abgesehen davon, dass man eine solche Frauengestalt, die sich verliebt, dann aber schließlich aus Familienräson einen anderen heiratet, den sie dann aber ersticht und letztlich selbst stirbt, überhaupt nicht darstellen, geschweige denn sein kann, scheint diese Partie der Netrebko nicht unbedingt auf den Leib geschrieben.
Trotzdem besticht diese Künstlerin vor allem durch ihre unauffällige Überpräsenz. Sie lässt nie die Primadonna heraushängen, auch nicht angesichts der Beifallsstürme an der Rampe. Und trotzdem ist sie allgegenwärtig.
Und dies vor allem musikalisch. Sei es mit den sicher und mit fast metallischer Strahlkraft gelandeten Hochtönen in den Ensembleszenen oder in der fast introvertierten Intimität ihrer Soli - hier vor allem in der Wahnsinnsarie. Ihre Stimme ist von dunkler Fraulichkeit. Und der Samt ihres Timbres wird auch in extremen Hochlagen nicht überdehnt. Sie liefert diese und auch die übrigen Arien als mit Intuition und perfekter Technik sensibel gestaltete Artefakte.
Zum Glück sind diese vom optischen Umfeld der trübseligen Repertoirevorstellung unabhängig. Sie werden jedoch durch Marco Armiliatos dirigentisches Temperament bestens unterstützt. Im Verein mit einer Glasharmonika als stimmungsvolles Begleitinstrument für die Wahnsinnsarie erhielt der Abend stellenweise dichtes musikalisches Format. Da können ansonsten nur noch Giuseppe Filianotis Tenor und George Peteans Bariton (mit Abstand) mithalten.
Staatsoper: Warten auf den Wahnsinn
„Lucia di Lammermoor“: Ein sehr gutes Ensemble mit Anna Netrebko inmitten macht die Vorstellung zum Feiertag im Repertoire. Die Sensation bleibt aus.
Was wurde auf die Werbetrommel eingedroschen! Anna Netrebko erstmals wieder in Wien und als Donizettis „Lucia di Lammermoor“, die Wahnsinnsarie nun endlich mit Glasharmonika, zusätzlicher Musik, in den wesentlichen Partien lauter Debüts.
In der Tat hat es im Haus am Ring so viel „Lucia“ noch nie gegeben: War da in der Vergangenheit nicht einmal das „Turmbild“ obligatorisch, die Konfrontation von Tenor und Bariton am Beginn des 3. Aktes, gab man diesmal auch die Szene von Sopran und Bass vor dem zweiten Finale – oder besser gesagt: einen größeren Teil davon. Denn hier ebenso wie in den wohlbekannten Teilen der Oper hat die Aufführungstradition allerorten so viele und zum Teil entstellende Kürzungen eingebürgert, dass die ganze „Lucia“ wohl nur auf CD zu hören ist.
Den Strich aufzumachen entpuppt sich freilich als dramaturgischer Gewinn: Erst der ehrenwerte, wohlmeinende Raimondo kann die verwirrte Lucia von der vermeintlichen Untreue Edgardos überzeugen, weshalb sie desto glaubwürdiger in die Ehe mit dem ungeliebten Arturo einwilligt. Bei Anna Netrebko wird diese Wende zum äußerlich unspektakulären, aber expressiven Höhepunkt: vergleichsweise unscheinbare Pianophrasen, die weit abseits hoher Töne und virtuosen Glanzes doch vom brennenden Schmerz eines gebrochenen Herzens künden. Es war einer jener raren Momente der Aufführung, an dem sich Netrebkos vokale und darstellerische Kräfte wirklich verbinden und potenzieren konnten. Denn sonst lag ihr Ausdruck mehr im Szenischen als im zwar gut differenzierten, aber dennoch gleichförmigen Gesang.
Die Unsicherheit des hohen Es
Nun sind ja im Belcanto-Repertoire weder Tonarten noch Spitzentöne in Stein gemeißelt, wie Aficionados wissen: „Casta diva“ im originalen G-Dur bleibt etwa auch bei den berühmtesten Normas eine Ausnahme, und Lucias „Il dolce suono“ stünde eigentlich gleichfalls einen Ganzton höher (F-Dur). Doch auch für die traditionelle, transponierte Fassung gilt: Das gefürchtete, weil grausam nackte hohe Es am Ende der (ja gar nicht von Donizetti stammenden) Kadenz war von Callas bis Gruberová stets eine Frage der Tagesverfassung.
Doch nicht die Sicherheit des hohen Es fehlt Netrebko für die Partie am meisten (immerhin wagt sie den Ton am Ende, nach etlichen hohen C und D im Laufe des Abends), sondern der letzte, aber entscheidende technische Schliff: Triller kann sie nur andeuten, bei raschen Läufen aspiriert sie zwar nicht, hinkt aber dennoch hinterher, bleibt mit ihrem gewiss reichen, dunklen Rotwein-Timbre um eine Nuance zu schwer, wo, sagen wir, Champagner prickeln sollte.
Staunen und Entsetzen, Jammern und Schaudern durchlebt das Publikum deshalb nicht bei Netrebkos Wahnsinnsszene: Der stärkste, der bleibende musikalische Eindruck geht von jener wahrlich überirdischen „armonia celeste“ aus, die Alexander Marguerre mit seiner Glasharmonika verströmt, damit Donizettis Vorstellungen endlich auch im Haus am Ring Genüge tut – und auch in der üblichen Kadenz die Rolle der Flöte übernimmt.
Die ganze „Lucia“ war das nicht
Die ganze „Lucia“: das wäre aber auch jener durch puren Gesang erzeugte Ausnahmezustand, in dem das Publikum gleichsam zu atmen vergisst – weil es eine körperliche Ahnung jenes Wahnsinns verspürt, dem Donizetti, ein Opfer der gerade in Theaterkreisen grassierenden Syphilis, schließlich selbst anheim fiel. Keine Spur davon diesmal: Wo Netrebko rührt, als Liebende, Verzweifelte, schließlich Irrsinnige, da tut sie es nicht durch ihre Stimme, sondern gleichsam neben dieser.
Dafür aber viel kapellmeisterliche Sorgfalt von Marco Armiliato am Pult des konzentrierten Orchesters, ein wackerer Chor – und ein gut zusammengestelltes, bemerkenswertes Ensemble: Tenorhoffnung Giuseppe Filianoti weiß außerordentlich weite Phrasen zu spinnen und singt den Edgardo einfühlsam, für mein Stilempfinden nur etwas dramatischer als nötig und wünschenswert, George Petean ist ein vokal sauber agierender, nobler Enrico, Stefan Kocán ein ordentlicher, hier aufgewerteter Raimondo, während Marian Talaba als Lucias Kurzzeitgatte Arturo, eine wahrlich undankbare Partie, auch sängerisch eher glücklos bleibt.
Das Publikum reagierte begeistert, aber nicht frenetisch – also gerecht. Auf diesem Niveau wünschte man sich das Staatsopern-Repertoire immer!
The best thing I saw in 2025 was Robinson Crusoé
vor 19 Stunden
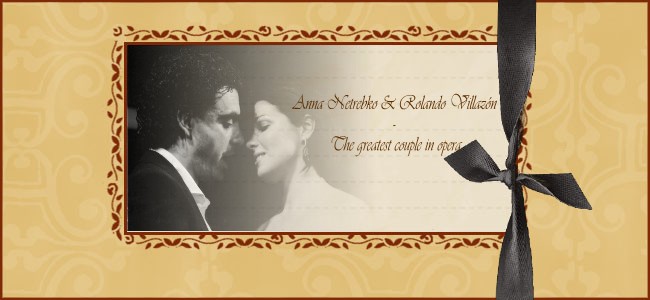


.jpg)



.jpg)

.jpg)


.jpg)


.png)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)


.jpg)
.jpg)





.jpg)
.jpg)


.bmp)


.jpg)

.jpg)




+2.jpg)
.jpg)






















Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen